Auf der Agenda: Reaktivierung von Eisenbahnstrecken
Unser Ziel für eine Mobilitätswende bis 2030 ist die Verdopplung der Fahrgastzahlen im öffentlichen Personenverkehr und ein Wachstum im Schienengüterverkehr um 25 Prozent. Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels und der Teilhabe der ländlichen Regionen an zukunftsfähigen und attraktiven Verkehrsangeboten ist die Reaktivierung von Bahnstrecken ein wichtiger Faktor, um mehr Menschen den Zugang zur Eisenbahn zu ermöglichen. Es müssen daher zügig verkehrlich sinnvolle Reaktivierungsvorhaben vorangetrieben werden, um rasch positive Effekte für den Klimawandel zu erzeugen.

Ergebnisse von Machbarkeitsstudien zu mehr als 75 Prozent positiv
Immer mehr Regionen in Deutschland haben Interesse daran, stillgelegte Schienenstrecken zu reaktivieren. Das zeigt die zunehmende Zahl an Studien, die in allen Teilen Deutschlands in Auftrag gegeben werden, um eine Reaktivierung zu prüfen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und die Allianz pro Schiene haben diese sogenannten Machbarkeitsstudien ausgewertet: Ganz überwiegend kommen sie zu einem positiven Ergebnis. Bei der Zahl der beauftragten Studien gibt es zwar große Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Insgesamt zeigt das stark gewachsene Interesse jedoch, dass die Reaktivierung von Schienenstrecken großes Potenzial hat, das ÖPNV-Angebot auch in der Fläche zu verbessern.
Martin Henke, Geschäftsführer Eisenbahnverkehr im VDV:
„Die Zahl der beauftragten Machbarkeitsstudien in Deutschland wächst praktisch täglich – damit ist das Thema Reaktivierung vor Ort angekommen. Für den Güterverkehr bietet die Reaktivierung stillgelegter Strecken ebenso großes Potenzial, daher wäre ein eigener Haushaltstitel auf Bundesebene das richtige Instrument, um auch bei der Wiederbelebung stillgelegter Güterverkehrsstrecken einen ähnlichen Boom auszulösen wie im Personenverkehr.“
Denn der Bund fördert die Reaktivierung stillgelegter Strecken über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz mit 90 Prozent der Kosten. Dies gilt allerdings nur für die Reaktivierung von Schienenwegen für den Personenverkehr.
4.573 Kilometer mehr Schienennetz durch Reaktivierung von Bahnstrecken
Der VDV und die Allianz pro Schiene schlagen die Reaktivierung von 277 Strecken mit 4573 km Länge vor. In der VDV-Broschüre werden 332 Städte und Gemeinden gelistet, die durch die vorgeschlagenen Reaktivierungen wieder Anschluss an das Bahnnetz erhalten könnten. Insgesamt 3,4 Millionen Einwohner sind betroffen.
Vorschläge für die Reaktivierung
(Mehrfachzählung bei mehreren durchfahrenen Ländern) sowie Veränderung gegenüber Vorauflage per Saldo
- Bremen: 1 (+/- 0)
- Hamburg: 1 (+/- 0)
- Saarland: 8 (+1)
- Berlin: 8 (+/- 0)
- Mecklenburg-Vorpommern: 9 (+ 2)
- Sachsen-Anhalt: 11 (+1)
- Thüringen: 13 (+ 2)
- Sachsen: 13 (+1)
- Schleswig-Holstein: 13 (+4)
- Rheinland-Pfalz: 16 (+3)
- Hessen: 18 (+4)
- Niedersachsen: 26 (+1)
- Bayern: 27 (+7)
- Brandenburg: 30 (+11)
- Baden-Württemberg: 43 (+1)
- Nordrhein-Westfalen: 61 (+1)
Der Anteil der in den neuen Bundesländern vorgeschlagenen Strecken liegt nach wie vor bei 28 %. Das entspricht fast dem Anteil der neuen Bundesländer an der Fläche der Bundesrepublik
Bottwartalbahn Heilbronn – Marbach (BW): 69.144 Einwohner
Brexbach- bzw. Holzbachtalbahn Engers - Siershahn - Selters – Altenkirchen (RP): 66.266 Einwohner
Wiehltalbahn Osberghausen – Waldbröl (NRW): 63.333 Einwohner
Abelitz – Aurich (NI): 60.359 Einwohner
Primstalbahn Dillingen – Primsweiler (SR): 54.219 Einwohner
Abzw Rheinkamp Süd – Kamp-Lintfort (NRW) 7.478
Tornesch – Uetersen (SH) 6.165
Wolfratshausen – Geretsried (BY) 5.055
Abelitz – Aurich (NI) 4.643
Iserlohn – Menden (NRW) 4.260
Dillingen – Primsweiler (SR) 4.171
Berlin-Wannsee – Stahnsdorf (B/BB) 3.810
Bedburg – Elsdorf West (NRW) 3.611
Abzw. Merzbrück – Würselen – Aachen Nord (NRW) 3.519
Abzw. Kellersberg – Siersdorf (NRW) 3.452
Bergkamen (NRW), 48.725 Einwohner
Aurich (NI), 41.991 Einwohner
Würselen (NRW), 38.712 Einwohner
Niederkassel (NRW), 38.218 Einwohner
Kamp-Lintfort (NRW), 37.391 Einwohner
Wermelskirchen (NRW), 34.765 Einwohner
Hemer (NRW), 34.080 Einwohner
Stuhr (NI), 33.678 Einwohner
Geesthacht (SH), 30.551 Einwohner
Taunusstein (HE), 30.005 Einwohner
Grenzüberschreitende Bahnstrecken
17 der Vorschläge betreffen grenzüberschreitende Verbindungen ins Ausland, davon vier in die Niederlande, zwei nach Belgien, vier nach Frankreich, eine in die Schweiz, fünf nach Tschechien und eine nach Polen.
Wiederbelebung stillgelegter Bahnstrecken lohnt sich

1 | Reaktivierung hilft dem Klima
Die Bundesregierung hat sich ausweislich des Koalitionsvertrages zum Ziel gesetzt, bis 2030 die Verkehrsleistung im Eisenbahnpersonenverkehr zu verdoppeln und gleichzeitig den Anteil des Schienengüterverkehrs am gesamten Güterverkehr auf 25 Prozent zu erhöhen. Eine von der Bundesregierung beauftragte Studie zur wissenschaftlichen Begleitung ihrer Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie hat Kosten und Potenziale zur Treibhausgasminderung der Reaktivierung stillgelegter Schienenstrecken untersucht. Die Studie belegt, dass die Reaktivierung von Schienenstrecken aus Umweltsicht sinnvoll ist.

2 | Reaktivierung stärkt strukturschwache Räume
Eine Anbindung an das Eisenbahnnetz stellt einen gravierenden Standortvorteil dar und fällt bei der Wahl des Wohnsitzes auch bei Autofahrern ins Gewicht. Bei der Auswahl von Strecken, die für eine Reaktivierung infrage kommen, ist daher der strukturpolitische Aspekt in die Überlegungen einzubeziehen.

3 | Mittelzentren brauchen einen Bahnanschluss
In Deutschland sind über 900 Orte als Mittelzentren eingestuft. 122 davon mit fast 1,8 Millionen Einwohnern sind nicht an das im Personenverkehr betriebene Bahnnetz (Eisenbahn, U-Bahn, Stadtbahn, Straßenbahn) angeschlossen. 119 dieser Orte wurden früher im Eisenbahnpersonenverkehr bedient. 44 davon haben auch heute noch einen Eisenbahnanschluss, der zwar nicht regelmäßig im Personenverkehr bedient wird, aber jederzeit für diese Verkehrsart wieder in Betrieb genommen werden kann. Ein weiterer Ort verfügte über einen Anschluss per Überlandstraßenbahn. Bei 67 der betreffenden Orte erscheint die Reaktivierung der Trassen für den SPNV sinnvoll und praktikabel. Damit könnten in den Mittelzentren fast 1,3 Millionen Einwohner wieder an den Eisenbahnpersonenverkehr angeschlossen werden.

4 | Reaktivierung bringt Chancen im Güterverkehr
Die „Hidden Champions“ der Industrie sind vielfach nicht in den Ballungsräumen, sondern auf dem Land zu finden. Viele der Betriebe generieren ein erhebliches Güteraufkommen, das nach Struktur und Menge für die Eisenbahn geeignet ist, und wurden dennoch von der Schiene abgehängt. In der Vergangenheit ist in einigen Fällen die Erhaltung von Strecken ausschließlich aufgrund des Güteraufkommens gelungen, so z. B. bei der Strecke Abelitz – Aurich auf Initiative der Fa. Enercon und bei der Strecke Altenkirchen – Selters auf Initiative der Fa. Schütz-Werke. Der Güterverkehr kann von der Infrastruktur ebenfalls profitieren, sofern bei der Planung die Notwendigkeiten dieser Verkehrsart hinreichend berücksichtigt werden.
Elektrifizierung der Bahnstrecken
Für ca. die Hälfte der Strecken (2.187 km) wird eine Elektrifizierung mit Oberleitung vorgeschlagen, für weitere 1.785 km ein elektrischer Betrieb mit Akkuhybridtriebwagen, die den Strom wahlweise aus Batterie und Oberleitung beziehen können. Für die restlichen 601 km kommt z.B. die Brennstoffzellentechnik in Betracht.
Die Allianz pro Schiene hat eine Übersichtskarte erstellt, die bereits erfolgte Reaktivierungen seit 1994 zeigt.
Neue Chancen durch verbesserte Finanzierungs- und Förderinstrumente
In der Vergangenheit war neben fehlenden Mitteln der Nachweis der Wirtschaftlichkeit eine häufig nicht zu überwindende Hürde für Reaktivierungsprojekte. Diesem Mangel hat der Bund durch Inkraftsetzung der neuen Verfahrensanleitung zur Ermittlung der Wirtschaftlichkeit im Rahmen der sogenannten Standardisierten Bewertung zum 1. Juli 2022 weitgehend abgeholfen. Die Einführung neuer Nutzenkomponenten wie der Lebenszyklusemissionen für Infrastruktur und Fahrzeuge, des impliziten Fahrgastnutzens sowie der Anrechnung des Nutzens gesellschaftlich auferlegter Investitionen in Brandschutz und Barrierefreiheit sowie weiterer fakultativer Nutzendimensionen des Klimaschutzes und der Wirkungen eines Vorhabens auf die Emissionen von Treibhausgasen machen es Reaktivierungsprojekten wesentlich leichter, die Wirtschaftlichkeitshürde zu überspringen.
Die neue Förderrichtlinie des Bundes für die Gleisanschlussförderung, die am 1. März 2021 in Kraft getreten ist, macht die Schaffung neuer und Reaktivierung bestehender Gleisanschlüsse attraktiver als bisher. Gefördert werden nun nicht mehr nur Aus- und Neubau, sondern auch Ersatzinvestitionen an Gleisanschlüssen sowie Investitionen an Zuführungs- und Industriestammgleisen, die bisher ausgenommen waren. Förderfähig sind nun auch multifunktionale Anlagen für den Umschlag Schiene/Straße an den Anschlüssen. Zudem wurden die Fördersätze und die Planungskostenpauschale erheblich erhöht. Dies hat zu einem erheblich gesteigerten Interesse aus Industrie und Logistik geführt, das auch auf das regionale Netz ausstrahlt.
Der Bund hat bei der Novellierung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG) in der letzten Legislaturperiode einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, den Reaktivierungsprojekten neuen Schwung zu verleihen. Die neunzigprozentige Förderung derartiger Projekte aus Bundesmitteln und der wesentlich größere finanzielle Rahmen des GVFG-Bundesprogramms erleichtert Ländern und Kommunen die Kofinanzierung und hat die Bereitschaft, sich bei solchen Projekten zu engagieren, erheblich verstärkt. Der Bund hat darüber hinaus nützliche Verfahrensanweisungen zur Interpretation des GVFG erlassen und stellt im Rahmen des Forschungsprojektes „Begleitende Maßnahmen für die Reaktivierung von Schienenstrecken“ weitere Handreichungen für Antragsteller zur Verfügung.
Forderung: Haushaltstitel für Güterstrecken und Moratorium
Es immer noch großen Handlungsbedarf: Der Güterverkehr muss stärker in die Reaktivierung des Streckennetzes einbezogen werden – mit eigenem Budget.
„Für die Reaktivierung reiner Güterstrecken, die Fabriken über dezentrale Güterverkehrszentren und Speditionsterminals bis hin zu dringend benötigten Ladestraßen in der Fläche anschließen, gibt es bislang keinen eigenen Haushaltstitel beim Bund, der auch entsprechend ausgestattet ist und über alle Bahnen, unabhängig vom Infrastrukturunternehmen, angelegt ist“, sagt Dr. Martin Henke; VDV-Geschäftsführer Eisenbahn. Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, fordert zudem, dass die Entwidmung stillgelegter Eisenbahntrassen – etwa um diese zu überbauen – gestoppt werden muss: „Wir müssen diese ungenutzten Trassen unbedingt sichern für künftige Reaktivierungen. Wenn auch nur punktuell ein Streckenabschnitt verbaut wird, dann ist der Verkehrsweg zerschnitten und die Chance auf eine Reaktivierung verloren. Wir brauchen dringend ein Moratorium bei der Entwidmung von Schienenstrecken."
Downloads
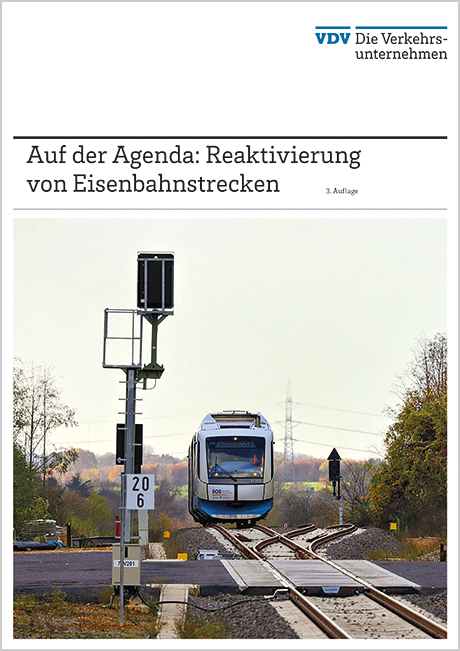
Zwei Jahre nach der letzten Ausgabe erscheint mit dieser Broschüre die dritte Auflage der Reaktivierungsvorschläge des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Die Intention der Vorauflagen war es, den stockenden Bemühungen zur Reaktivierung von Eisenbahnstrecken neuen Schwung zu geben. Tatsächlich ist dies in großem Umfang gelungen: Unsere Vorschläge haben in den Medien und der Politik eine enorme Resonanz erfahren, die nicht auf Deutschland beschränkt war. Viele der Vorschläge wurden konkret von politischen oder administrativen Entscheidungsträgern aufgegriffen und Schritte zu ihrer Realisierung unternommen. Besonders bemerkenswert ist, dass alle Bundesländer Programme unterschiedlicher Art für die Reaktivierung von Schienenstrecken aufgelegt haben und viele Projekte aus unserer Liste darin aufgenommen haben. Befürchtungen, mit der schon in der Erstauflage recht langen Liste unserer Vorschläge zu weit gegangen zu sein, haben sich nicht bewahrheitet. Die Länder gehen in einzelnen Fällen mit zusätzlich angeschobenen Projekten zum Teil sogar über unsere Liste hinaus. Dies ist neben der Tatsache, dass einige der Projekte bereits erfolgreich abgeschlossen wurden, einer der Gründe für diese Neuauflage.
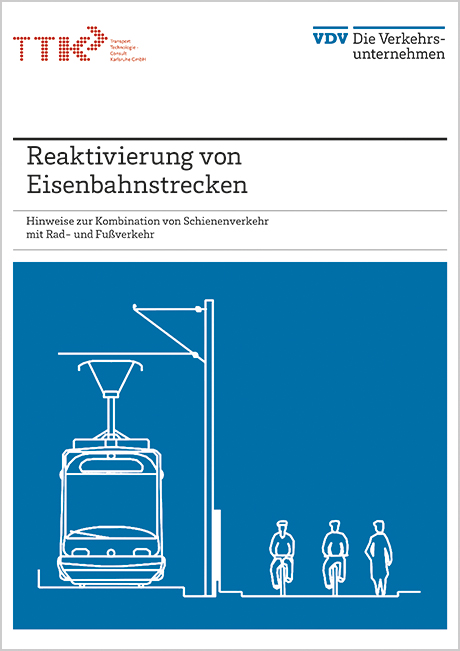
Eine weitere Herausforderung für die Reaktivierung von Eisenbahnstrecken ist die Konkurrenz um die Nutzung der Trassen mit dem Radverkehr als weiterem klimafreundlichem Verkehrsträger. Vielfach wurden nach kompletter Stilllegung der Strecken die Trassen für die Anlage attraktiver Rad- und Wanderwege genutzt – größtenteils im Übrigen zur Sicherung der Trasse für einen späteren Bahnverkehr. Dies ist nur heute nicht mehr gänzlich allen in Erinnerung geblieben. Um aber dennoch Konflikte zu vermeiden sollen Wege zur Koexistenz beider Nutzungsarten aufgezeigt werden. Der VDV hat zu diesem Zweck eine Studie unter dem Titel „Reaktivierung von Eisenbahnstrecken - Hinweise zur Kombination von Schienenverkehr mit Rad- und Fußverkehr“ in Auftrag gegeben, die qualifizierte Vorschläge zur Kombination beider Nutzungen durch eine systematische Aufarbeitung von Regelquerschnitten sowohl nach EBO als auch nach BOStrab macht.
Weitere Informationen